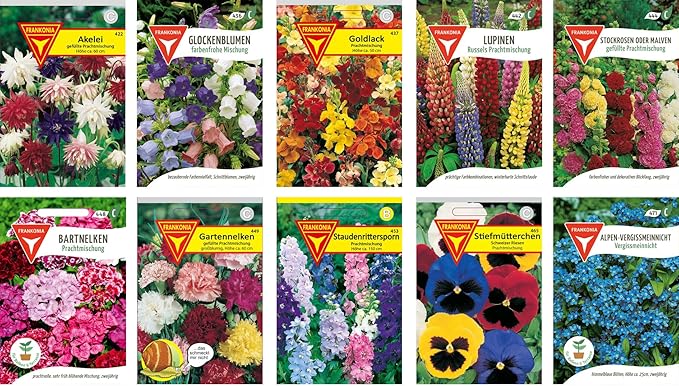3. April 2025, 12:23 Uhr | Lesezeit: 4 Minuten
Pflanzen haben kein Gehirn und kein zentrales Nervensystem – dennoch können sie sich an Umweltstress erinnern und sich entsprechend anpassen. Wie ist das möglich? Forscher haben sich dieser Frage bereits angenommen – mit interessanten Ergebnissen.
Wassermangel, plötzlicher Frost oder das Abfressen durch Tiere: All diese Vorkommnisse lösen bei Pflanzen akuten Stress aus. Denn sie bedrohen direkt oder indirekt das Leben der Pflanze. Anders als Menschen oder Tiere können Pflanzen aber nicht einfach den Standort wechseln und sich Wasser oder eine warme Behausung suchen. Deshalb haben viele Pflanzen komplexe biologische Mechanismen entwickelt, um auf Erfahrungen dieser Art nicht nur zu reagieren, sondern sich durch eine Art Erinnerungsvermögen besser auf Stress in der Zukunft vorbereiten zu können. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für nachfolgende Generationen.
Übersicht
Erinnerung bei Pflanzen ohne Gehirn erforscht
Hitzestress zwingt viele Pflanzen in die Knie, besonders wenn dieser dank Klimawandel immer häufiger und intensiver vorkommt. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie und an der Universität Potsdam haben bereits 2021 anhand dieses Beispiels untersucht, ob und wie Pflanzen auf molekularer Ebene eine Art Gedächtnis ausbilden.
Hierfür haben die Forscher Arabidospis-Keimlinge, also Keimlinge der Gänserauke, in zwei Versuchen Hitzestress ausgesetzt. Beim ersten Versuch wurden die Keimlinge zuerst für kurze Zeit einem geringen Hitzestress ausgesetzt, den sie schadlos überstehen konnten. Dieses Vorgehen wird Priming genannt.
Anschließend haben die Wissenschaftler dieselben Keimlinge einem erhöhten Hitzestress bei einer Temperatur von 44 Grad Celsius ausgesetzt. Im zweiten Versuch bekamen die Vergleichskeimlinge direkt die hohen Temperaturen ab, ohne Priming. Es zeigte sich: Die Gänserauke-Keimlinge, die durch Priming nicht auf den höheren Hitzestress vorbereitet waren, starben bei diesem mehrheitlich ab.
Daraus schlussfolgerten die Forschenden, dass die Pflanzen in ihren Stammzellen eine Art Gedächtnis für extreme Bedingungen schaffen, um nach dem ersten Kontakt mit Hitzestress auf einen höheren Stresslevel mit veränderten Stoffwechselvorgängen reagieren zu können. Dadurch kann sich die Pflanze besser gegen Umwelteinflüsse schützen. Statt durch eine andauernde Hitzewelle einfach abzusterben, verlangsamt die Pflanze nur stark. Diese Erkenntnis ist zum Beispiel auch für die Landwirtschaft interessant, da sie zum Beispiel bewirkt, dass Pflanzen die Blütenbildung hinauszögern, wenn Hitzestress auftritt. Dies wiederum kann Ernteausfälle mindern.
Weitergabe von Stresserinnerungen an die nächste Generation
Besonders bemerkenswert ist, dass Pflanzen ihre Erfahrungen unter Stress weitergeben können. Wenn eine Pflanze wiederholt Stress erlebt, vererbt diese bestimmte epigenetische Veränderungen in den Samen weiter. Dadurch sind die Nachkommen besser auf ähnliche Bedingungen vorbereitet.
Auch interessant: „Super-Pflanze“ reinigt Raumluft 30-mal effektiver als andere Pflanzen
Ein Beispiel hierfür sind Pflanzen, die wiederholt Dürreperioden ausgesetzt waren. Die nächste Generation kann oft schneller auf Wassermangel reagieren, indem sie früher ihre Spaltöffnungen schließen oder tiefere Wurzeln bilden. Bei Gersten-Mutterpflanzen wurde außerdem in Versuchen beobachtet, dass wenn sie Trockenstress ausgesetzt waren, die nächste Generation schneller keimt. Die Keimlinge sind dann früher widerstandsfähig gegen eventuell auftretende Dürreperioden als Keimlinge, deren Mutterpflanze diese Erfahrungen nicht gemacht haben.

Pflanzen vereinzeln Worauf man beim Pikieren von Tomaten achten sollte
Wie werden Pflanzen in meinem Garten stressresistenter?
Wer einen Garten oder Balkon hat, hat es ebenfalls häufig mit möglichen Stressfaktoren für Pflanzen zu tun. Hierzu gehören neben den Klassikern wie Hitze- und Trockenstress auch Schädlinge oder eben auch plötzlich stark abfallende Temperaturen.
Ein anschauliches Beispiel hierfür ist der Zeitpunkt zwischen der Anzucht von Obst- und Gemüsepflanzen auf der Fensterbank und dem Auspflanzen ins Freie. Oft liest man den Hinweis, die jungen Pflanzen nach und nach an die Außentemperaturen zu gewöhnen. Tomatenpflanzen würden etwa bei einem Temperatursprung von 20 Grad drinnen und fünf Grad draußen in der Nacht sehr wahrscheinlich absterben oder zumindest Schaden nehmen. Wer sie allerdings zunächst tagsüber für ein paar Tage an die Außenwelt gewöhnt und sie erst dann auch über Nacht draußen lässt oder ins Beet einsetzt, hat eine vielversprechende Chance auf eine reiche Tomatenernte.
Ähnlich wie bei dem Beispiel mit der Gänserauke entwickeln die Tomatenpflanzen aus unserem Beispiel bei vorsichtigem Gewöhnen an die Außenwelt eine gewisse Resistenz gegen geringere Temperaturen und nehmen sie weniger als Stressfaktoren wahr. Sie werden also, in Anlehnung an die erwähnte Versuchsreihe, geprimed. Wer diesen Mechanismus beim Gärtnern bedenkt, kann sich (und seinen Pflanzen) mit ein wenig Geschick viel Stress und im Zweifel eine verlorene Ernte ersparen.