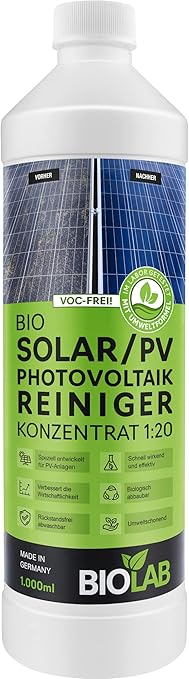10. März 2025, 17:07 Uhr | Lesezeit: 4 Minuten
Photovoltaikanlagen boomen – bringen aber auch Herausforderungen mit sich. Wer ab März 2025 eine neue PV-Anlage in Betrieb nimmt, muss sich auf einige Änderungen einstellen. Was das konkret bedeutet, erfahren Sie in dieser Übersicht.
Am 25. Februar 2025 trat das „Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen“ – auch Solarspitzengesetz genannt – in Kraft. Damit gehen einige neue Regelungen für Betreiber von PV-Anlagen ab März 2025 einher. Ziel ist eine bessere Steuerung der Netzeinspeisung, um Überlastungen zu vermeiden. Besonders betroffen sind neue Anlagen.
Warum wurde das Solarspitzengesetz eingeführt?
Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 2024 lag der PV-Anteil an der Nettostromerzeugung laut Fraunhofer ISE bereits bei rund 14 Prozent. An sonnigen Tagen wird dadurch mehr Strom erzeugt, als tatsächlich benötigt wird. Die Folge: Die Preise an der Strombörse fallen zeitweise ins Negative. Um eine bessere Steuerung der Einspeisung zu ermöglichen und Netzüberlastungen zu vermeiden, wurde das sogenannte Solarspitzengesetz beschlossen – das nun in Kraft getreten ist.
Diese Änderungen gelten ab März 2025
Betreiber neuer PV-Anlagen müssen sich auf drei zentrale Neuerungen einstellen:
1. Keine Einspeisevergütung bei negativen Strompreisen
Der Strompreis an der Börse schwankt je nach Angebot und Nachfrage und kann bei einem Überangebot sogar negativ werden. Konkret bedeutet das, dass zu viel Strom im Netz ist. Bisher erhielten Betreiber von PV-Anlagen dennoch eine garantierte Einspeisevergütung – unabhängig von der Marktlage.
Das ändert sich nun: Fällt der Börsenpreis unter null Cent pro Kilowattstunde, entfällt die Einspeisevergütung für neu installierte Anlagen. Um Verluste zu minimieren, können Betreiber versuchen, durch intelligentes Energiemanagement den Eigenverbrauch optimieren. Ein Beispiel hierfür ist das Laden eines E-Autos über eine eigene Wallbox, die mit selbst erzeugtem Solarstrom betrieben wird. Zudem verlängert sich die Förderdauer der Solaranlage um die vergütungsfreien Zeiten.
2. Smart Meter und Steuerbox werden Pflicht
Neue PV-Anlagen mit einer Nennleistung ab sieben Kilowatt-Peak (kWp) müssen künftig mit einem intelligenten Messsystem (Smart Meter) und einer digitalen Steuereinheit ausgestattet sein. Dies ermöglicht es Netzbetreibern, die Einspeiseleistung flexibel zu regulieren, wenn eine Überlastung droht. Den Einbau übernehmen die örtlichen Messstellenbetreiber.
Sollte eine Anlage ohne die vorgeschriebene Messtechnik in Betrieb gehen – beispielsweise wegen Verzögerungen beim Einbau –, ist die Einspeisung auf 60 Prozent der Nennleistung begrenzt. Diese Regelung bleibt bestehen, bis die erforderliche Technik nachgerüstet wurde.
Passend dazu: Brauche ich für einen Smart Meter einen neuen Zählerschrank?
3. Vereinfachte Direktvermarktung von Solarstrom
Für Anlagen mit einer Nennleistung unter 100 kWp sinken die Hürden für die Direktvermarktung. Das bedeutet: Betreiber können ihren Solarstrom direkt zu Börsenpreisen verkaufen, ohne aufwendige bürokratische Verfahren durchlaufen zu müssen. Dabei ist gewährleistet, dass die Vergütung mindestens der Einspeisevergütung entspricht. Bei niedrigeren Börsenpreisen gibt es entsprechende Ausgleichszahlungen.
Zudem ist es erlaubt, mit gespeichertem Netzstrom zu handeln. So können Batteriespeicher in Zeiten günstiger Preise mit Netzstrom geladen und der Strom später zu höheren Preisen verkauft werden. Wie genau die Direktvermarktung für private Haushalte ausgestaltet ist, bleibt allerdings noch abzuwarten, da das Gesetz dazu keine detaillierten Vorgaben macht.
Wer ist vom Solarspitzengesetz betroffen?
Die neuen Regelungen zur Einspeisevergütung und zur Pflicht für Smart Meter gelten für alle PV-Anlagen, die ab dem Tag nach der Veröffentlichung des Gesetzes in Betrieb genommen wurden. Bestandsanlagen sind nicht betroffen, es sei denn, die Betreiber entscheiden sich freiwillig für die neuen Vorgaben.
In diesem Fall erhöht sich die bestehende Einspeisevergütung um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Kleinere Balkonkraftwerke mit einer Wechselrichterleistung von maximal 800 Watt und einer Modulleistung von bis zu 2000 Watt sind von den neuen Regelungen ausgenommen.

Einspeisung kostet Staat Milliarden Strafzahlung statt Vergütung für Solarstrom gefordert! Die Folgen für private Betreiber

Änderung jetzt in Kraft Zu diesen Zeiten bekommen PV-Betreiber weniger Geld für eingespeisten Strom

Solaranlagen Was sich bei Photovoltaik ab 1. August ändert
Kompensierung bei negativen Strompreisen
Die Neuregelung des § 51 EEG verschiebt die Förderung bei negativen Börsenstrompreisen für neue PV-Anlagen auf einen späteren Zeitraum, um sie stärker an Markt- und Preissignale anzupassen. Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit wird der Kompensationsmechanismus (§ 51a EEG) verbessert: Die entgangene Vergütung wird nach Ablauf der gesetzlichen Förderzeit nachgeholt, wobei das Ertragspotenzial berücksichtigt wird.
Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft e.V. entstehen für PV-Betreiber dadurch keine Nachteile. Durch intelligente Nutzung und Speicherung ihres Solarstroms könnten sie sogar wirtschaftlich profitieren – und indirekt dazu beitragen, Belastungsspitzen künftig zu vermeiden.

Weniger Vergütung für PV-Betreiber?
„Mit dem Solarspitzengesetz werden neue PV-Anlagen ab März 2025 stärker in das Netzmanagement eingebunden. Wer eine neue Anlage installiert, erhält keine Einspeisevergütung mehr, wenn der Strompreis an der Börse negativ ist, kann jedoch von einer längeren Förderdauer profitieren. Ob sich das für Betreiber auch langfristig lohnt, bleibt abzuwarten.“